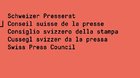Drei Viertel der jungen Erwachsenen hören mindestens eine Stunde pro Tag Radio und zwei Drittel schauen mindestens eine Stunde fern. Dies zeigt eine Befragung von 50 000 jungen Männern und 1800 jungen Frauen der Eidgenössischen Kommission ch-x. Doch wieso wurden dabei nur so wenig Frauen befragt? Der Klein Report hat nachgefragt.
Die Studie «Lebensstile, Konsum und Zukunftsperspektiven junger Erwachsener in der Schweiz» verspricht Antworten zu Fragen der aktuellen Lebens- und Zukunftsvorstellungen von jungen Erwachsenen und der Rolle, die neue Medien im Leben einer der «ersten Generationen von Digital Natives» spielen.
Die Befragung wurde dabei von der Eidgenössische Kommission ch-x durchgeführt, die rechtlich und finanziell ins Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) integriert ist. Die Ergebnisse zeigen, dass drei Viertel der jungen Erwachsenen mindestens eine Stunde pro Tag Radio hören und etwa zwei Drittel der Befragten pro Tag mindestens eine Stunde TV schauen.
Dabei neigen Personen mit einem höheren elterlichen Bildungshintergrund zu unterdurchschnittlichem TV-Konsum, so die Studie weiter. Zudem würden 86 Prozent der jungen Erwachsenen mindestens einmal täglich im Internet surfen.
Was beim Lesen der Studie aber noch mehr auffällt als die Ergebnisse selbst: Bei der Erhebung wurden zwar 50 000 Männer, jedoch nur gerade 1800 Frauen befragt. Diese geschlechterspezifische Diskrepanz scheint doch gerade bei einer Erhebung durch eine eidgenössische Kommission erklärungsbedürftig. Wie ein genauerer Blick zeigt, sind die Gründe rein pragmatischer Natur.
So führt ch-x ihre Befragungen in Schweizer Rekrutierungszentren durch, es werden also alle stellungspflichtigen Männer in einem Jahr direkt bei der Aushebung befragt. Damit erreiche man «einen Abdeckungsgrad von nahezu 100 Prozent der 19-jährigen Schweizer», wie der Klein Report auf Nachfrage erfahren hat.
Diese Praxis sei dabei historisch aus den Pädagogischen Rekrutenprüfungen gewachsen, mit denen seit Mitte des 19. Jahrhunderts die schulischen Fähigkeiten der jungen Männer zum Vergleich von kantonalen Volksschulen erhoben wurden. Diese Prüfungen gibt es heute zwar nicht mehr, die Jugendbefragung ist aber geblieben. Seit den 1960er Jahren werden Themen aus der Welt der jugendlichen Erwachsenen wissenschaftlich untersucht.
Doch so schön ein hoher Abdeckungsgrad bei den Männern aus wissenschaftlicher Sicht auch sein mag, bliebt die Frage nach der Repräsentation der Frauen. Beantwortet wurde diese dem Klein Report von Umfrageleiter Robin Samuel, Assistenzprofessor an der Université du Luxembourg.
Laut Samuel wurden die Antworten der Frauen in der Studie «Lebensstile, Konsum und Zukunftsperspektiven junger Erwachsener in der Schweiz» anhand einer «Ergänzungsstichprobe» erhoben. Die ungleiche Verteilung sei «durch Gewichtung» korrigiert worden.
Auf gut Deutsch bedeutet dies, dass die befragten Frauen bewusst nach bestimmten Merkmalen wie zum Beispiel ihrem Wohnort ausgesucht wurden. Dadurch soll erreicht werden, dass die wenigen Befragten einen möglichst grossen Teil der jungen Frauen in diesem Alter repräsentieren, also quasi stellvertretend für die Gesamtheit der jungen Frauen stehen. Durch die höhere Gewichtung ihrer Antworten wurde der Unterschied in der erhobenen Fallzahl im Vergleich zu den Männern zusätzlich nivelliert.