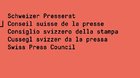Der ehemalige Reporter Tom Kummer ist erst kürzlich aus Los Angeles zurückgekehrt. Im zweiten Teil des Klein-Report-Interviews enerviert sich der Journalist, der früher selbst Interviews inszenierte, über «Fake News» und erzählt aus seiner Kindheit.
Spätestens seit Donald Trump die US-Wahlen gewonnen hat, ist der Term «Fake News» in aller Munde. Während Medien sich gegenseitig die Verbreitung von Unwahrheiten vorwerfen, gehen die Leserzahlen etablierter Institutionen zurück. Die Menschen wollen schnelle und kostenlose Nachrichten. Ganz generell: Was halten Sie heute von der Thematik «Fake News»?
Tom Kummer: «´Fake News` halte ich für bösartige Viren. Das sind Meinungsmanipulationen, die eine politische oder PR-mässige Stossrichtung verfolgen, mit dem Ziel: Macht. Der Begriff ´Fake-News` kam erst mit den Sozialen Medien auf, wo sich diese Viren ja brutal schnell vermehren können. Meine inszenierten Interviews waren in erster Linie ´Gespräche mit mir selbst`, sie gehörten in die Rubrik ´Unterhaltungsjournalismus`, vielleicht sogar Literatur, sie wurden in den Wochenendbeilagen abgedruckt und sollten Lesegenuss und Spass verbreiten.»
Sie haben früher selber gewissermassen «Fake-Journalismus» betrieben. Sie nannten es Borderline-Journalismus. Haben Sie damals nicht auch Lügen publiziert?
Kummer: «Mit ´Fake News` hatte das nichts zu tun. Meine Texte waren seitenlang, sollten sich wie Short Stories lesen, überraschen, aufrütteln und waren natürlich auch satirisch und selbstironisch gefärbt. Man kann nicht sagen, dass dies manipulative Werke waren, die einer politischen Bewegung, einem Unternehmen oder einem Präsidenten helfen sollten, Macht zu erhalten. Meine Texte gehören eindeutig zu einer anderen Zeitrechnung im Print-Journalismus. Viele Leute wurden süchtig danach.»
Inwiefern hat sich die Problematik seit Ihren «Fake Interviews» verändert, was ist gleich geblieben?
Kummer: «Das Magazin ´Der Spiegel` warb kürzlich mal wieder mit seiner Faktenchecker-Abteilung und dem Satz: ´Wir glauben zuerst mal gar nichts.` Das suggeriert die Stossrichtung, die heute alle Medienunternehmen vorgeben: ´Wir drucken nur noch die Wahrheit!` Über so ein Versprechen bin ich natürlich echt froh. Denn ich frage mich ja noch heute: Wie definieren Medien die Wahrheit? Wie entsteht mediale Wirklichkeit? Ich war immer überzeugt, dass Wirklichkeit in den Medien konstruiert wird. Was denn sonst? Das ist ja das Wunderbare an der Kunst der Reflexion.»
Sie haben also bewusst den Übergang zwischen Fakten und Reflexion offengelassen.
Kummer: «Ich habe das nie explizit in meinen Texten gekennzeichnet, sondern mit in die Story eingebunden, als ´stream of consciousness`. Das liegt doch in der Natur des kreativen Prozesses des Schreibens oder beim Film- und Tonschnitt. Nun muss man also davon ausgehen, dass Kreativität und Textexperimente aus den Printmedien verbannt worden sind, denn wie soll man sonst dem Versprechen nachkommen, nur noch die absolute Wahrheit zu liefern? Man kann sich also heute nur glücklich schätzen, nicht unter dem Label ´Journalist` veröffentlichen zu müssen.»
Hat sich Ihre eigene Ansicht durch die aktuelle Debatte geändert?
Kummer: «Ich kenne die aktuelle Debatte nicht. Jene Medienlandschaft, die ich noch mitbekommen habe, wurde fast nur von Moralaposteln, Faktenhubern und Erbsenzählern dominiert, die das Wahrheitsmonopol der Medien zu verteidigen versuchten. Ganz früher, zu meiner Kindheit, da fand ich die Watergate-Story und das Märchen um ´Journalisten sind die wahren Helden` eine Weile auch ganz niedlich. Da war ich zwölf Jahre alt, und die ´Washington Post` operierte unter dem edlen Status, den viele noch heute als die ´Vierte Macht im Staat` bezeichnen. Ich fände es wunderbar, aber auch wunderbar naiv, wenn junge Journalisten heute noch immer mit dieser Absicht ihre Karriere antreten würden, um genau dieses Grundrecht der Pressefreit durchzusetzen und den Mächtigen das Leben schwer zu machen.»
Was sollen junge Journalisten denn sonst tun?
Kummer: «Da fände ich es echt besser, einen Molotov-Cocktail zu werfen oder sich als den nächsten Bansky zu bezeichnen. Aber egal. Ich bin ja auch mit träumerischen Absichten in das Reich der Printmedien geraten. Für mich war Journalismus nämlich immer bloss ein Vehikel, um zu veröffentlichen, was immer ich gerade denken und schreiben will. Gnadenlos subjektiv war das Ziel. Sprache und Stilisierungen sind wichtiger als Fakten. Regeln sind zum Brechen da. Freedom of Speech nannte sich das mal. Diese Zeiten sind vorbei.»