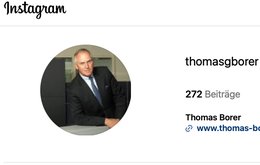Es war die grösste aussenpolitische Krise der Schweiz seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges: die Debatte um die nachrichtenlosen Vermögen von Holocaust-Opfern auf Schweizer Banken. Ex-Botschafter Thomas Borer blickt in einem neuen Buch hinter die Kulissen.
Das Werk beschreibt eine diplomatische Krise der Schweiz in den Jahren 1996 bis 1999 im Zusammenhang mit nachrichtenlosen Vermögen jüdischer Holocaust-Opfer auf Schweizer Banken. Am 21. November 1996 kam es zu einem ersten entscheidenden Treffen zwischen Thomas Borer, dem Leiter der neu geschaffenen «Task-Force Schweiz – Zweiter Weltkrieg», und Israel Singer, dem Vorsitzenden des World Jewish Congress (WJC).
Singer forderte moralische und finanzielle Wiedergutmachung sowie die Errichtung einer Institution für Holocaust-Opfer. Im Gegenzug bot er einen «Weihnachtsfrieden» an – eine mediale Waffenruhe, um Verhandlungen zu ermöglichen.
Borer stimmte dem Vorschlag unter der Bedingung zu, dass die Angriffe aus den USA vorübergehend eingestellt würden. Der «Weihnachtsfrieden» sollte vom 11. Dezember 1996 bis zum 15. Januar 1997 gelten. Zurück in Bern informierte Borer die Bundesratsmitglieder, die den gewonnenen Zeitaufschub begrüssten. Dennoch warnte die Task-Force eindringlich vor der prekären Lage und empfahl eine rasche, symbolische Geste wie die Einrichtung eines Fonds. Diese Empfehlung wurde jedoch von Bundesrat und führenden Vertretern des Finanzplatzes abgelehnt – man wollte auf Zeit spielen und die Feiertage abwarten.
Die Geschichte liest sich wie ein Krimi – auch weil für eine diplomatische Lösung Ansätze gesucht wurden, die an einen «James Bond»-Film erinnern. Für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit wurden Sprachregelungen ausgegeben, doch einzelne Bundesräte begannen bald, sich öffentlich unkoordiniert und zunehmend aggressiv zu äussern. Besonders verhängnisvoll war ein Interview des abtretenden Bundespräsidenten Pascal Delamuraz, der die Diskussion um die Holocaust-Gelder als Angriff auf den Schweizer Finanzplatz bezeichnete und die Einrichtung eines Hilfsfonds als Erpressung abtat. Diese Äusserungen lösten eine weltweite Protestwelle aus und verschärften die internationale Kritik an der Schweiz erheblich.
Die Krise gipfelte schliesslich in einem historischen Vergleich am 12. August 1998, bei dem Schweizer Banken sich verpflichteten, 1,25 Milliarden Franken an Holocaust-Überlebende und ihre Nachkommen zu zahlen. Dieser Vergleich beendete viele der offenen Ansprüche und markierte den Beginn einer neuen Phase in der internationalen Wahrnehmung der Schweiz.
Borers Darstellung ist persönlich und detailreich – und genau deshalb sehr glaubwürdig und fesselnd. Er würdigt die Arbeit seiner Task-Force und betont, dass der diplomatische Erfolg nur durch deren Einsatz möglich gewesen sei. Seine Rückschau bietet nicht nur einen historischen Überblick, sondern auch einen seltenen Einblick in die komplexen diplomatischen Prozesse hinter einer der grössten aussenpolitischen Krisen der Schweizer Nachkriegsgeschichte. Eine hochinteressante Lektüre – bestimmt.
Voraussetzungen sind aber Ausdauer und zeitliche Freiheiten: Borers historische Abhandlung umfasst fünf Bände mit über 2’800 Seiten.