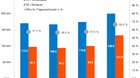Was halten die verschiedenen Parteien eigentlich vom Schutz der Journalisten vor digitaler Überwachung oder von der Idee eines «Whistleblower-Gesetzes»? Und wie soll mit Regierungen umgegangen werden, die die Pressefreiheit mit Füssen treten? Wenige Tage vor der deutschen Bundestagswahl hat der Klein Report die wichtigsten Positionen einer Meinungsumfrage zusammengestellt.
«Mit Sorge» betrachtet die deutsche FDP die innenpolitische Entwicklung und die «politische Kontrolle der Medien», wie sie sich «in einigen EU-Staaten» zurzeit verschärft, steht in der umfangreichen Umfrage, die Reporter ohne Grenzen am Dienstag publiziert hat. Die Liberalen wollen sich in der nächsten Legislatur für eine «Reform der Rechtsstaatskontrolle» starkmachen, «um bei dauerhaften Verletzungen unserer Werte auch unterhalb der Schwelle des Stimmentzugs wirksame Sanktionen verhängen zu können».
Mit Ländern, die es nicht so genau nehmen mit der Pressefreiheit, könne ein «Rechtsstaatsdialog» geführt werden, findet die SPD. Dieses Instrument hat die EU-Kommission als ein «Vorverfahren» eingerichtet, um auf Mitgliedstaaten, die Grundwerte verletzen, einzuwirken, ohne ein offizielles Sanktionsverfahren anschieben zu müssen. Die unlängst diskutierten Kürzungen von EU-Fördermitteln lehnen die Sozialdemokraten ab, weil es die Falschen treffen würde.
Auf die Schwerfälligkeit rechtsverbindlicher EU-Sanktionen beruft sich die CDU. Weil ein Stimmrechtsentzug gegen ein EU-Mitglied nur beschlossen werden könnte, wenn alle übrigen EU-Mitglieder zustimmten, will die CDU soweit wie möglich auf einen «konstruktiven Dialog» setzen.
Journalistisch pikant ist auch die Frage, wie weit der Machtkreis der Geheimdienste abgesteckt sein soll. Die Liberalen lehnen die «anlasslose, massenhafte Überwachung» ab. Das neue Nachrichtendienstgesetz sei zum Teil problematisch. Zum Beispiel will die FDP in das vom Parlament berufene «G10-Gremium», das entscheidet, ob der Bundesnachrichtendienst in das Post- und Fernmeldegeheimnis eingreifen muss und darf, einen «Betroffenenvertreter» entsenden.
Für die SPD muss es in allen Prozessordnungen und Ermittlungsstadien «denselben hohen Schutz geben», die Rechtslage sei disparat. Das gilt konkret für das Zeugnisverweigerungsrecht und den Informantenschutz, für selbstrecherchiertes Material und den Schutz vor Beschlagnahmung. Auch ein «absoluter Schutz aller Berufsgeheimnisträger», der in der gesetzlichen Regelung der Telekomüberwachung rausgefallen ist, müsse nochmals diskutiert werden.
Aus Sicht der Grünen müssen Medienangehörige dem «absoluten Schutz vor verdeckten Ermittlungsmassnahmen» unterstellt werden. Für die CDU besteht zurzeit kein Handlungsbedarf.
Auch bei der Idee eines «Whistleblower-Gesetzes» gehen die Meinungen auseinander. Die SPD verweist auf die «Panama Papers» und Gammelfleischskandale und fordert, dass das «couragierte Handeln» von Informanten, die zur Aufdeckung solcher Misstände führt, besser geschützt wird.
Die Gewissheit für Whistleblower, aufgrund ihrer Hinweise keine Nachteile befürchten zu müssen, könne «nur durch entsprechende gesetzliche Regelungen erzeugt» werden, werden die Sozialdemokraten in der Umfrage weiter zitiert. Zudem kündigen sie kurz vor den Bundestags-Wahlen an, ein nationales «Presseauskunftgesetz» schaffen zu wollen.
Ähnlich sehen es die Grünen, die ein «Gesetz zum Schutz von Whistleblowern» kreieren wollen. Es soll Whisleblower vor Kündigung oder Strafverfolgung schützen, der Schutz der Staatsgeheimnisse soll im Gegenzug gelockert werden.
Sichtlich gemünzt auf die Bombe, die Edward Snwoden einst zum Platzen gebracht hat, will die FDP eine Art Ombudsmann für Mitarbeiter der Nachrichtendienste schaffen: Der parlamentarisch Gewählte soll «Anliegen zum inneren Zustand eines Dienstes, ohne Einhaltung des Dienstweges», entgegennehmen.
Ansonsten sei die Rechtslage «weitestgehend ausreichend», schreiben die Liberalen und zitieren das Kündigungsschutzgesetz und das zivilrechtliche Massregelungsverbot.
Gar keinen Handlungsbedarf gibts für die CDU. Die Merkel-Partei befürchtet sogar, dass «Fake News» und Verleumdung «durch verfehlten Schutz» gefördert werden könnten.