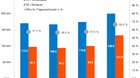Welchen Beitrag kann die Kommunikationswissenschaft leisten, um die Medienpraxis zu verbessern? Und warum thematisieren die Medien sich selber nicht? Diese Fragen diskutierten Forscher und Praktiker in Winterthur. Es werde sehr wohl über die Medien berichtet, sagte der Verleger Norbert Neininger: Jeder Journalist werde von etwa 15 Leuten beobachtet. Für den Klein Report fasst Roger Blum die Diskussion zusammen.
Norbert Neininger, Verleger und Chefredaktor der «Schaffhauser Nachrichten», hält wenig von der wissenschaftlichen Medienforschung. Die Befunde des «Jahrbuchs Qualität der Medien» des Zürcher Publizistikprofessors Kurt Imhof und seines Teams kenne man längst schon ohne Forschung. Zudem seien die Erkenntnisse banal. Das Forscherteam des Jahrbuchs gehe vom ideologischen Standpunkt des Aufklärungsliberalismus aus und dies sei fragwürdig. Er fand es anmassend, wenn Forscher bestimmen wollen, was Qualität in den Medien sei. Die Redaktionen fühlten sich von der Wissenschaft in ihrer praktischen Arbeit nicht verstanden. Man kämpfe zurzeit ums Überleben, sagte Neininger, da seien die Journalisten nicht gerade erpicht auf Prügel aus der Wissenschaft.
Mark Eisenegger, Leiter des Forschungsbereichs Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög), der das Jahrbuch erstellt hat, und zurzeit Gastprofessor an der Universität Salzburg, erläuterte, dass der Aufklärungsliberalismus die Grundlage geschaffen habe für die Demokratie und den öffentlichen Diskurs und deshalb die unabdingbare Voraussetzung sei für die heutigen Medien. Die Befunde des Jahrbuchs mögen banal erscheinen, aber sie hätten eine gesellschaftliche Relevanz. Eisenegger betonte, dass das Forscherteam durchaus lernfähig sei und auf Kritik eingehe. Die Medienjournalisten Rainer Stadler (NZZ) und Nick Lüthi («Medienwoche») bestätigten, dass sich die Auseinandersetzung mit dem Jahrbuch lohne. Lüthi sagte, er verstehe nicht, weshalb das Medienunternehmen Tamedia die Berichterstattung darüber verboten hatte.
Professor Stephan Russ-Mohl von der Universität Lugano kritisierte, dass sich die Schweizer Verleger der Realität verweigern und nicht einsehen wollen, dass die Vielfalt im Mediensystem abnehme. Die Medien müssten vermehrt darüber aufklären, wie Journalismus funktioniert. Nur so könnte im Publikum ein Qualitätsbewusstsein entstehen, das dazu führt, dass die Leute auch bereit seien, für Medien einen angemessenen Preis zu bezahlen. Norbert Neininger widersprach dem Vorwurf, dass die Medien nicht über die Medien berichteten. «Jeder Journalist wird von etwa 15 Leuten beobachtet», sagte er - von der Wissenschaft, von PR-Büros, von Politikern.
Roger de Weck, Generaldirektor der SRG, betonte, es gebe bei den Medien leider nur ein mässiges Interesse an Medienkritik. Das Jahrbuch benenne durchaus alarmierende Zustände. Ein Teil der Medien entferne sich von der Aufklärung und höhle die Pressefreiheit aus. Der Abbau von Auslandkorrespondenten beispielsweise sei im Zeitalter der Globalisierung eine Katastrophe. Vielfach herrsche bloss nach «Speditionsjournalismus» vor: Die Information werde wie eine Ware weitergeleitet, und die wichtigen journalistischen Funktionen der Einordnung und Vertiefung blieben aus. Die Medien müssten einen Mehrwert herstellen, sonst brauche man sie bald nicht mehr, sagte de Weck.
Die von Marianne Erdin moderierte Podiumsdiskussion fand im Rahmen der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM) statt, der 170 Personen beiwohnten. Vor der Diskussion hatten Esther Kamber und Linard Udris vom fög nochmals aufgezeigt, welchen Leitlinien das «Jahrbuch Qualität der Medien» folgt und welche Resonanz es ausgelöst hat. Das Jahrbuch ist 2012 zum dritten Mal erschienen. Schon am Anfang der Jahrestagung, die dem Thema Transdisziplinarität in der Kommunikations- und Medienwissenschaft galt, kam das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis zur Sprache: Vinzenz Wyss, Professor an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Präsident der SGKM, verwies darauf, dass sich Wissenschaft und Praxis oft schlecht verstünden, aber dass es auch gute Erfahrungen gebe, vor allem in den Bereichen der Medienregulierung, der Medienpsychologie und der Medienwirkungsforschung. Das Fach müsse immer wieder seine Leistungsfähigkeit in der Anwendung unter Beweis stellen.
Daniel Perrin, Professor für Medienlinguistik und Direktor des gastgebenden Instituts für Angewandte Medienwissenschaft, sprach über Qualitätskriterien transdisziplinärer Forschung: Transdisziplinarität wolle praktisch relevante Probleme nachhaltig lösen. Wenn man aber die Praxis verbessern wolle, müsse man sie kennen. Es brauche daher einen laufenden Diskurs zwischen Forschung und Praxis. Dabei handle es sich oft um Gespräche zwischen zwei Kulturen. Die gemeinsame Sprache zu finden, sei ein wichtiger Teil der Arbeit, denn die Praxis wolle einfache Lösungen, die Wissenschaft wolle die Komplexität sichtbar machen. Daher sei der ständige Kontakt und Austausch unerlässlich.