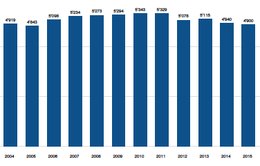Wie sähe die Medienlandschaft Schweiz aus, wenn es Print nicht mehr gäbe? Und wie finanzierten die Medienanbieter ihre Inhalte? Eine vom Verlegerverband Schweizer Medien in Auftrag gegebene Studie zeichnet ein «ermutigendes» Zukunftsszenario.
Der Zeitschnitt ist radikal: Das komplett digitale Szenario, das die Studie des Oltener Beratungsunternehmens Polynomics entwirft, überspringt die gegenwärtige, mitunter schmerzhafte Transformationsphase. Es skizziert eine Schweizer Medienlandschaft, in der Medien ausschliesslich digital produziert, konsumiert und bezahlt werden.
Die Druckereien und den physischen Vertrieb gibt es nicht mehr. Google und Facebook gewinnen in der Verbreitung journalistischer Inhalte weiter an Bedeutung. «Die Nachfrage nach publizistischen Inhalten steigt weiter an», wenn ihre Nutzung auch mobile und webbasiert stattfindet.
In Druck und Vertrieb summieren sich heute rund die Hälfte der Kosten einer abonnierten Tageszeitung. Sinken die Kosten, fallen bisherige Markteintrittshürden weg, womit der Wettbewerbsdruck steigt. Dies wird aus Sicht der Autoren zu neuen Geschäftsmodellen, Angebotsvielfalt und «verstärkt qualitativ differenzierten Produkten» führen: «Damit nimmt die Medienvielfalt zu», so der optimistische Ausblick.
Die Gretchenfrage ist natürlich, wie sich diese durchdigitalisierte Medienwelt rechnen wird, wenn nicht nur die Distributionskosten sinken, sondern auch die Aufmerksamkeit und Werbegelder zu den neuen Akteuren, allen voran den Suchmaschinen und Sozialen Netzwerken, abwandern.
Das Polynomics-Szenario setzt zu guten Stücken auf die Zahlungsbereitschaft der Nutzer. Aus Sicht der Autoren kann in einer Demokratie wie der Schweiz die Nachfrage nach qualitativ guten journalistischen Medieninhalten «als gegeben angenommen werden»: Nur wer sich informiere, könne sich eine solide Meinung zu den anstehenden politischen Entscheidungen bilden.
«Diese Nachfrage wird sich auch weiterhin in einer entsprechenden Zahlungsbereitschaft äussern.» Digitale Abos, Mikropayment für einzelne gelesene Artikel oder Direktentschädigung der Medienschaffenden über Portale wie Patreon sehen die Autoren als mögliche Wege, die zahlungswilligen User zur Kasse zu bitten.
Auch die Finanzierung von journalistischen Inhalten «über den Verkauf anderer Produkte» sei «denkbar». Die New Yorker Agentur Bloomberg News finanziere sich zum Beispiel durch den Verkauf von Terminals und den zu deren Betrieb notwendigen Daten, wählen die Autoren geschickt ein ausländisches Beispiel. Und schliesslich werden auch Stiftungen und Crowd-Funding als neue Geldquellen digitaler Titel genannt.
Weniger optimistisch, was die Freigebigkeit der Mediennutzer anbetrifft, ist die Eidgenössische Medienkommission. In ihrer vor zwei Wochen publizierten Prognose geht das Gremium davon aus, dass die Zahlungsbereitschaft der Digital-User, die sich Gratis-Content en masse gewöhnt sind, auch in Zukunft «äusserst gering bleibt».
Die Polynomics-Autoren formulieren die Unabwägbarkeiten allgemeiner: Wie es aus heutiger Sicht «äusserst schwierig» sei, «die künftige Marktstruktur der Medien in einer vollständig digitalisierten Welt abzuschätzen, ist es schwierig, die künftigen Finanzierungsquellen der Medien zu antizipieren».
Der Bedeutungszuwachs der Nutzerfinanzierung bringe auch das «Risiko einer Zwei-Klassen-Gesellschaft» mit sich, greift das vom Verlegerverband in Auftrag gegebene Papier schliesslich ein weiteres Argument aus dem laufenden Diskurs auf. Sollten wegen der versiegenden anderen Geldquellen die Nutzerpreise steigen, könnte sich ein Graben auftun zwischen jenen, die sich qualitativ hochstehende Informationen leisten können, und jenen, die sich mit Billigerem begnügen müssen - mit dem negativen Rattenschwanz für den demokratischen Prozess, wie er in der Service-public-Debatte diskutiert wird.
Doch bereits heute gebe es unterschiedlich gut informierte Bürger. Das Problem sehen die Autoren nicht in diesen Unterschieden, sondern in der Möglichkeit, dass sich im Zuge der Digitalisierung traditionelle Zeitungsleser von ihrem Informationsverhalten verabschieden und auf günstigere Angebote umsteigen. «Sind letztere zwingend qualitativ schlechter? Wird es für diese Personen weniger Möglichkeiten geben, sich über alternative Medien genügend gut zu informieren? In diesem Punkt sind wir skeptisch.»